
Facebook veröffentlichte kürzlich neue Quartalszahlen. Das Unternehmen verzeichnet grosse Erfolge: «Gegenüber dem Vorjahr verdreifachte das weltgrößte Online-Netzwerk seinen Gewinn. Nach 719 Millionen Dollar im zweiten Quartal 2015 flossen zwischen April und Juni des aktuellen Jahres 2,1 Milliarden Dollar (rund 1,9 Mrd. Euro) in die Kassen. Der Umsatz stieg um 59 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar» (siehe Futurezone-Artikel). Dieser Erfolg ist grösstenteils auf die Werbung zurückzuführen, die Facebook in seiner Mobilapp platziert. «Mit Werbung und Nutzerdaten zum Milliardenerfolg», so lautet der Titel des zitierten Plogposts.
Als Nutzer/innen nehmen wir im Internet viele Angebote in Anspruch, die uns kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Soziale Plattformen (LinkedIn, Facebook, Twitter), Fotogallerien (Apple Fotos, Google Photos, Picasa), Videoarchive (Youtube, Vimeo) usw. Früher musste man teure Software wie Photoshop kaufen, um Bilder bearbeiten zu können, heute kann man gratis mit Pixlr arbeiten.
– Ok, gratis?
– Wie definierst du gratis?
– Ich werde nicht zur Kasse gebeten.
– Nein, wirst du natürlich nicht. Aber glaubst du deshalb, dass du die Plattform gratis nutzt?
– Ich bin schon nicht blöd und weiss natürlich, dass ein Service-Anbieter im Web nicht nur Geld mit Leuten verdient, die für den Dienst bezahlen, weil sie den ganzen Komfort und den kompletten Funktionsumfang einer Applikation in Anspruch nehmen wollen. Der Anbieter wird auch Geld verdienen, indem er Daten von mir sammelt. Na und?
– Andrew Lewis, ein kanadischer Software-Entwickler und Berater hat den Satz in Umlauf gebracht: «If you are not paying for it, you’re not the customer; you’re the product being sold». Man kriegt nichts geschenkt im Leben!
– Ja, ja, gut gebrüllt, Löwe! Weisst du, mich stört es, dass man Werbung immer als per se schlecht brandmarkt. Dabei leben wir in einer Welt mit einem Überangebot an Dingen und da ist es nur natürlich, dass Anbieter für ihr Produkt Werbung machen. Werbung finanziert Content, das war schon vor dem Internet so. Ich erinnere mich an die Gelben Seiten, ein Branchentelefonbuch, das gratis verteilt wurde (und auch heute noch wird). Das war mit hunderten von Anzeigen finanziert. Zeitschriften und Zeitungen enthielten schon immer Anzeigen und Werbung, sogar Bücher, die RoRoRo-Taschenbücher mit der Werbung für Pfandbriefe und Zigar…
– (ins Wort fallend): … aber hör mal: du bist wirklich naiv! Damals konnten wir noch klar unterscheiden, was Anzeige war und was nicht. Heute verschwimmt diese Grenze zusehens. Was in einem Blog als Nachricht oder Bericht daher kommt, ist vielleicht ein bezahlter Artikel. Eine Rezension wird oft nur geschrieben, um das Buch zu verkaufen. Was als unabhängiger Journalismus daher kommt, ist oft einfach Werbung. Mich nervt das. Das Internet besteht am Ende dieser Entwicklung nur noch aus Werbebannern und niemand will es wahrhaben. Eine Anzeige in einer Zeitung kann ich ignorieren, im Internet weiss ich nicht mal, was ich ignorieren soll und was nicht, und zudem werde ich nicht ignoriert, sondern auf Schritt und tritt verfolgt. Das ist wie ein orientalischer Bazar, nur in den Ferien als Exotik zu ertragen und nicht sehr lange.
– In den frühen Jahres des Internets sprachen alle vom Cyberspace als von einer Parallelwelt, in der alles anders ist als in der richtigen Welt. Das war gewissermassen exotisch. Natürlich war in diesem Paradies in den Wolken jedes Angebot frei und gratis. Dann griffen die Händler und Investoren in das Geschehen ein und fanden eine Kultur vor, wo bisherige Geschäftsmodelle versagten. Die Internetnutzer waren nicht gewillt, für Content zu bezahlen. Es herrschte die Vorstellung vor, dass die User den Content auf demokratische Weise (d.h. frei von Bezahlung und Umsatzinteressen) selber produzieren können. Das Paradebeispiel für diese Art der Nicht-Ökonomie waren Wikis (mit «Wikipedia» als Referenz-Applikation) und die Blogs. Am Rand der Legalität sollten auch Musik und Filme frei zugänglich sein. Nachrichten und Wissen sowieso. Die ersten Träume vom Internet als Marktplatz scheiterten an dieser Ideologie der Cyber-Allmend, die Investitionswolke platzte. Dann kamen Google und Amazon, wurden zu Quasimonopolen der Suche und des globalen Buchhandels und machte der Welt vor, wie Wirtschaft im Internet funktioniert. Ein attraktiver, kostenfreier Service, der sich im Fall von Google über Anzeigen finanziert.
– Ja, ja wissen wir ja alle. Die Geschichte löst aber nicht die Probleme, die heute anstehen. Erstens wurde mit dieser Entwicklung das Internet zur Litfasssäule und zweitens sollten wir so rasch wie möglich überlegen, wie wir gegensteuern, um vor dem Eisberg der Kulturkatastrophe auszuweichen. Das Internet ist drauf und dran, die alte Tradition eines freien und kritischen Journalismus zu zerstören. Und nicht nur das.
– Du kannst doch nicht den Lauf der Dinge aufhalten oder das Rad der Geschichte zurückdrehen. Was ich dir sagen will ist, dass Werbung viel besser geworden ist. Früher wurde ich mit Anzeigen für Produkte und Dienstleistungen bombardiert, die für mich keine Bedeutung hatten. Heute erhalte ich relevante Werbung für Produkte, die mich interessieren könnten.
Wir verlassen diese Diskussion gerade noch, bevor sie gehässig oder gar handgreiflich wird ;-). Ehrlich gesagt, weiss der Autor nicht, welcher der Kontrahenten recht hat, der kritische oder der eher naive, und vor allem hat er keine Ahnung, wohin die Reise mit der Internet-Ökonomie in naher Zukunft geht. Wird das Internet zur besagten Litfasssäule oder sehen Kunden ein, dass sie für qualitativ hochwertige und störungs- bzw. werbefreie Applikationen zahlen müssen?
Der Streit wird heute auf der Ebene des Datenschutzes ausgetragen. Europa versucht gegenüber Amerika seine strengeren Datenschutzgesetze durchzusetzen. Das führt stellenweise zu grotesken Situationen: Die Universität als kantonale Verwaltung muss mit teurer Software arbeiten, die weit hinter dem Komfort freier Softwareangebote von Google zurückbleiben. Das ist auf der einen Seite sehr polemisch gemeint: Wir zahlen viel Geld für IBM Connections und ärgern uns damit herum, dabei bietet Google funktionierende Cloudsoftware weitgehend kostenfrei an. Auf der anderen Seite kämpfen wir aber um unsere Rechte als Konsumenten und als Personen, die mehr sind und vielschichtiger als ein Nutzerprofil – z.B. eben jemand mit einer Privatsphäre.
Leichter zu beantworten ist die Frage, auf welche Weise Sie als Akademiker/innen sich in diesem Konflikt verhalten – nicht welche Meinungen Sie haben, sondern ganz konkret, was Sie am Computer, Pad und Mobiltelefon unternehmen, oft eher unbewusst als bewusst:
- Sie können für Services und Content bezahlen, weil Sie es sich leisten können, und vertrauen darauf, dass dadurch Ihre Daten nicht für Werbezwecke verwendet werden. Für Zeitungsabos und Bücher sind wir wohl am ehesten bereit, Geld auszugeben. Zeitungsabos gehörten ja schon immer zu unserem Konsumportfolio. Vermutlich ist es mit Inhalten aus dem Internet wie mit Ökogemüse oder Ökostrom: Je mehr Konsumenten gewillt sind für Qualität zu zahlen, desto mehr Qualität kann produziert werden.
- Sie meiden das Internet. Ihre Artikel und Bücher können Sie auch offline schreiben. Das scheint jemandem wie mir, der mit dem und im Internet lebt, etwas weltfremd, aber konsequent. Doch seien Sie dabei bitte kein Snob, der vom hohen Ross der staatlich finanzierten Content-Produktion auf den Sumpf des Internets hinunter schaut. Hier ist ausserdem noch anzumerken, dass diese Strategie vermutlich nicht mehr lange möglich ist. In ein paar Jahren werden Schreibprogramme vermutlich ausschliesslich online funktionieren. Software soll ja mobiltauglich sein. Auch MS Word wird funktionieren wie Google Docs (tut es eigentlich heute schon). Wesentlich wird sein: Da Sie sich nicht mit der Internet-Technologie auseinandergesetzt haben, werden Sie nicht wissen, wie sie Sie diese Funktionen ausschalten können. Noch schlimmer: Sie werden vielleicht online sein, ohne es zu wissen.
- Sie installieren einen Ad-Blocker im Browser, weil das viele machen, und verdrängen das Problem. Einige Webseiten sind mittlerweile so schlau und zeigen Content bei eingeschaltetem Blocker nicht mehr an. Eigentlich verständlich, nicht wahr?
- Sie installieren ein «Privacy Plugin» (wie z.B. mypermissions.com), um zu wissen, welcher Service wann und wie auf Ihre Daten zugreift. Jedes Mal, wenn ein Anbieter ihre Daten abzusaugen droht, meldet sich das Teil, und Sie stehen vor der Wahl, entweder nicht weiterarbeiten zu können (diese Option werden Sie selten wählen) oder die Daten halt preiszugeben. Dieser Weg ist wie eine Psychotherapie erst einmal schmerzhaft, aber am Ende möglicherweise heilsam. Allerdings bringt das Verfahren – genau wie die Therapie – die Ursache nicht aus der Welt, es lässt Sie nur mit dem Schmerz besser leben.
- Sie sind tendenziell zahlungsunwillig, denn Sie sind es sich gewohnt, dass Content in den Bibliotheken frei für Sie zur Verfügung steht. Das Internet soll sein, wie die Zentralbibliothek, nur noch grösser. Sie wenden lieber Zeit auf, um Inhalte gratis im Web zu beschaffen und setzen sich womöglich auch mal dubiosen Geschäftspraktiken aus.
Das sind die Strategien, die Sie als Privatperson verfolgen können. Vielleicht fahren Sie eine Mischstrategie. Habe ich etwas Wesentliches vergessen? Benutzen Sie gerne die Kommentarfunktion dieses Blogs.
Dieser Beitrag ist Angeregt von einem Blogpost von Sebastian Wolfsteiner auf seinem Blog Emvolution https://blog.emvolution.me/2016/07/warum-werbeprofile-der-kuhhandel-des-21-jahrhunderts-sind/ und publiziert bei Linked-In-Pulse: (5.7.16)
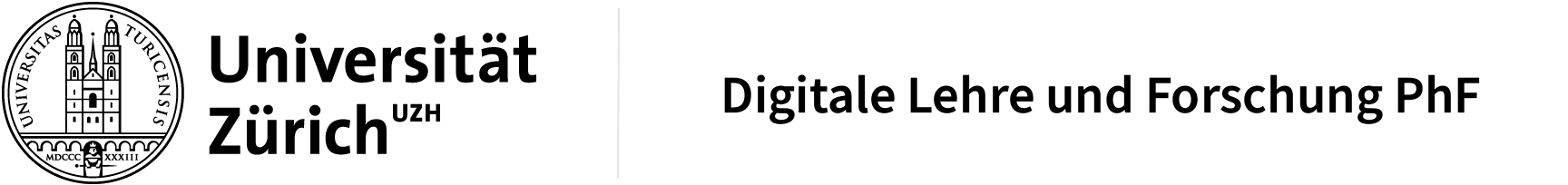
Danke David, für deine ausführliche Antwort mit der wichtigen Ergänzung, dass Dienste eingestellt werden können und die NutzerInnen damit teils mit erheblichen Probleme da stehen. Das erste, was ich mir bei jedem Dienst anschaue, sind die Import-und Exportmöglichkeiten und Formate. Vorher fange ich nicht an, ihn zu nutzen. Auch ich habe mir die Finger verbrannt. Wer nicht.
Ich wollte eigentlich nicht auf unzulängliche Weise vereinfachen, sondern polemisch zuspitzen und dabei war ich tatsächlich ein wenig naiv oder kurz. Mir ist klar, dass eine Institution wie die UZH, wenn sie Google-Cloudsoftware nutzen würde, auch dafür bezahlen müsste. Ich habe die Sache aus der Sicht eines Unternehmens geschildert, das einfach sagen würde: ich kaufe keine Software mehr, sondern weise meine Mitarbeitenden an, Google Dienste zu nutzen. Daten lassen sich verschlüsseln und das reicht mir als Sicherheit für meine Unternehmensdaten. Auch als Dozent, gesehen als Privatperson, nicht als Beauftragter der Uni, könnte ich mit Google alles, was die meisten unserer Dozierenden mit OLAT machen, mit Google-Tools viel einfacher und für die UZH gratis machen. In zweiter Linie stellt sich dann für eine Institution die selbe Frage wie für eine Einzelperson: Gratis oder Bezahlung. Und das hätte ich auch sagen müssen, da hast du sehr recht, David.
Aber da beisst die Maus keinen Faden ab: Ich oder wir als Team wären in funktionaler Hinsicht mit Google-Drive besser bedient als mit IBM Software, die sich anfühlt wie Applikationen von früher. Und das Problem wird aus dieser Sicht ja dadurch verschärft, dass Drive nur ein Mausklick weg ist. «Oh so close but yet so far».
Interessanter Blogbeitrag. Allerdings muss man aufpassen, dass man nicht vereinfacht. So würde auch Google von der UZH Geld verlangen falls z.B. die Groupware von Google genutzt werden sollte. Kostenlose Photoshop-Alternativen gibt es auch schon seit Langen. Aber eines zeichnet alle aus, sie kommen nicht an den Funktionsumfang des Originals heran. Für mich wäre interessant zu wissen, wie sich, abgesehen von den ganz grossen Playern wie Google oder Facebook, all die kleineren Anbieter finanzieren. Kaum über Werbung. Ich vermute, dass viele Dienste nicht rentieren und darin liegt für mich eine grosse Gefahr. Denn es kann sein, dass ein Dienst plötzlich eingestellt wird und der User muss dann sehen, was er macht. Wenn es dumm geht, kann er seine Daten nicht einfach in ein anderes Programm exportieren. Beispiele dafür gibt es genug. Ich hatte für einen Verein den Cloud File Share von Wuala (Seagate), der wurde relativ zackig eingestellt und ich hatte einen erheblichen Aufwand. Für eine mobile App (Abfuhrdaten Münchenstein) brauche ich ein Backend, da setzte ich Parse ein (welches Facebook gehörte). auch Parse wurde ersatzlos gestrichen und ich musste mehrere Tage investieren bis die App mit einem anderen Backend wieder funktionierte. Auch für das Internet gilt die Nachhaltigkeit zu beachten. Dies gilt für Gratis-Angebote wie für bezahlte. Für mich ist klar, ich überlege mir jeweils ob eine Firma mit ihrem Business Modell rentieren kann oder nicht. Falls nein trage ich ein rel. grosses Risiko, dass der Dienst bald wieder eingestellt oder plötzlich teurer wird.